Liebe Leser:innen,
mein Name ist Sophie Weigand und das ist die erste Ausgabe meines kleinen Sachbuchnewsletters Nonfiction. Ich möchte hier künftig einmal im Monat zwei bis drei lohnenswerte Sachbücher aus den Bereichen Gesellschaft, Politik, Kultur und Wissenschaft vorstellen.
Kleines Intro zu mir: Ich bin Buchhändlerin, Kulturwissenschaftlerin und freiberufliche Literaturredakteurin bei der Buchkultur und dem Büchergilde Magazin. In der Buchhandlung betreue ich den u. a. den Sachbuchbereich.
Genug der einleitenden Worte, los geht’s.
Hässlichkeit ist ein soziales Konstrukt. Moshtari Hilal stellt in ihrem einzigartigen, poetischen Essay die Frage nach den Ursprüngen und dem Nutzen dieses Konstrukts. Dabei geht es um rassifizierte Körpermerkmale, die Anfänge der Schönheitschirurgie und darum, was Darwins Evolutionslehre mit den einst populären „Freakshows“ zu tun hatte, in denen Menschen mit abweichenden Körperformen ausgestellt und herabgewürdigt wurden.
Hilal gelingt eine hellsichtige Verknüpfung von persönlicher Erfahrung und kritischer Zeitdiagnose. Wenn Normschönheit mithilfe von Filtern längst Alltag ist, wenn operative Eingriffe in manchen Kreisen nahezu obligatorisch werden – wird Schönheit dann zur Klassenfrage? Wie könnte eine Gesellschaft aussehen, die ohne die Abwertung des Abweichenden funktioniert? Hässlichkeit steckt voller kluger Einsichten und liefert unzählige Anknüpfungspunkte, die eigene Wahrnehmung von anderen und sich selbst zu hinterfragen.
Eine Besonderheit: Der Text ist stilistisch vielfältig, sachliche Schilderungen und Recherchen wechseln sich ab mit lyrischen, surrealistischen Passagen. Zwischendrin gibt es Fotos und Screenshots, etwa von Instagram oder TikTok. Eine ungewöhnliche, aber extrem lohnenswerte Herangehensweise!
Moshtari Hilal: Hässlichkeit. Hanser Verlag. 224 Seiten. 23,00 €.
Sehr viele gute Bücher sind schon über Gewalt gegen Frauen geschrieben worden (etwa das kürzlich erschienene Gegen Frauenhass von Christina Clemm oder Femizide von Julia Cruschwitz und Carolin Haentjes). Asha Hedayati konzentriert sich in Die stille Gewalt vor allem auf gewaltbegünstigende Strukturen in Gesellschaft, Justiz und dem institutionellen Hilfesystem. Sie schildert z. B., wie Frauen von Familiengerichten dazu gezwungen werden, ihre Kinder weiterhin zum gewalttätigen Ex-Partner zu bringen, weil der Umgang „kindeswohldienlich“ sei. Im Interview mit dem ZEIT Magazin erklärt Hedayati, in welche Dilemmata Frauen mitunter gebracht werden, die sich und ihre Kinder vor weiterer Gewalt zu schützen versuchen:
„Auch vor den Familiengerichten gibt es wieder diese einseitige Fixierung auf das Verhalten der Mutter: Sie soll sich trennen, wenn nicht, werden ihre Kinder in Obhut genommen. Und wenn sie ihre Kinder schützen will, wird ihr vorgeworfen, sie zu gefährden, wenn sie den Kontakt zum Vater unterbindet.“ (Das ganze Interview gibt es hier zum Nachlesen)
Die stille Gewalt legt bloß, wie staatliche Regelungen und Gesetze die finanzielle Abhängigkeit von Frauen (unbeabsichtigt) fördern, etwa in Form des Ehegattensplittings. Entscheiden sich Frauen dafür, Kinder zu bekommen, müssen sie mit erheblichen Einkommenseinbußen rechnen, migrantische Frauen erleben häufig, dass sie von ihren Partnern mit ihrem unsicheren Aufenthaltsstatus erpresst werden. Überhaupt wird in der Beurteilung von Gewalt häufig mit zweierlei Maß gemessen, je nachdem, ob es sich um deutsche oder nicht deutsche Täter handelt. Frauenhäuser sind, ähnlich wie die Sozialarbeit oder die Jugendämter, katastrophal unterbesetzt und unterfinanziert, eine desolate Lage auf dem Wohnungsmarkt sorgt häufig dafür, dass eine Trennung vom gewalttätigen Partner Frauen vor nahezu unüberwindbare organisatorische Hürden stellt. Hedayatis Buch legt den Finger in die Wunde. Es macht extrem wütend, aber gerade deshalb ist es so wichtig!
Ergänzung: Correctiv hat in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung kürzlich eine Recherche zu Väterrechtlern an Familiengerichten veröffentlicht: Die Netzwerke der Väterrechtler. Die Ergebnisse stützen und bestätigen viele von Hedayatis Beobachtungen in ihrer alltäglichen Arbeit.
Asha Hedayati: Die stille Gewalt. Rowohlt Verlag. 192 Seiten. 18,00 €.
*
Das war’s fürs Erste. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Lesen.
Sophie
Wenn ihr Lust auf regelmäßige Sachbuchtipps habt, könnt ihr Nonfiction hier abonnieren:




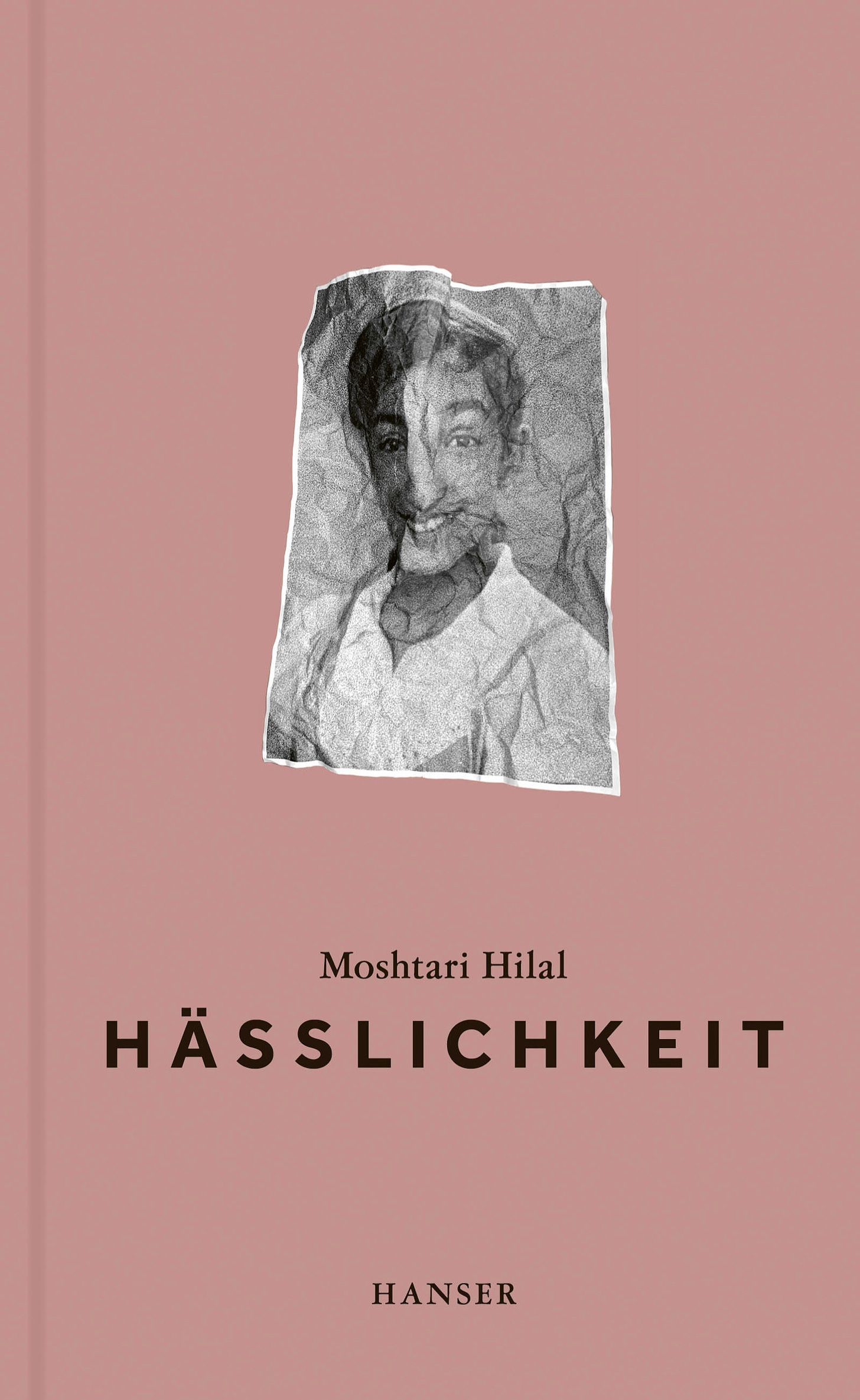
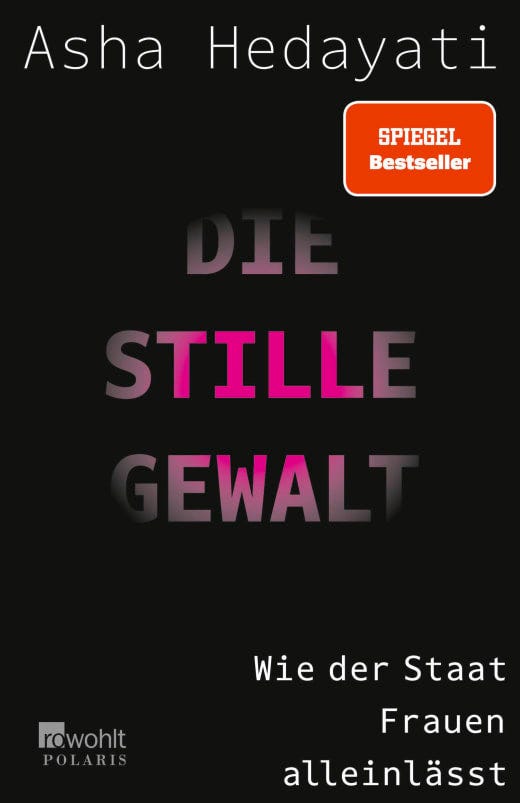
Willkommen bei Substack und vielen Dank für die Buchtipps, auf die ich auch schon ein Auge geworfen hatte. Bin auch gerade in einer Sachbuch-Lesephase, da trifft sich das gut.🙂